Hagar Peeters: „Malva“
Gespräch
Niederländische Gastautorin in Oldenburg 2021
Der seit 2005 jährlich stattfindende Besuch eines niederländischsprachigen Gastautors am Institut für Niederlandistik der Universität und im Literaturhaus wurde, wie so vieles andere, von Corona kalt erwischt. Nachdem wir zusammen mit der ursprünglich für Mai 2020 eingeladenen Autorin Hagar Peeters schon früh entschieden hatten, ihren Besuch um ein Jahr zu verschieben, wurde im Laufe des Winters klar, dass auch im Mai 2021 ein Besuch in Präsenz nicht möglich sein würde. Stattdessen nahm Hagar Peeters am 18. Mai 2021 online an einer Sitzung des Seminars teil, das sich das ganze Sommersemester 2021 mit ihrem Roman Malva (2015) beschäftig hatte.
Hagar Peeters Erzählerin in Malva beobachtet das Geschehen aus dem Jenseits und erzählt die Geschichte ihres berühmten Vaters Pablo Neruda ganz neu: Die Ehe ihrer Eltern, die Trennung von seiner ersten Frau und der Tochter Malva und auch sein Ruhm als Dichter erscheinen in einem neuen Licht, wenn seine Tochter zu Wort kommt. Im realen Leben wurde Malva Marina Trinidad del Carmen Reyes nur acht Jahre alt, da sie mit einem Hydrozephalus zur Welt kam und bis zu ihrem frühen Tod gesundheitlich beeinträchtigt war. Bald nach der Geburt entzog sich ihr Vater Neruda aller Verpflichtungen, wollte sich mit ihrer Erkrankung nicht belasten. In einem surrealistischen Jenseits umgibt Malva sich mit Personen, mit denen sie das Verhalten ihres Vaters und ihr eigenes Schicksal bespricht – Ausnahmegestalten wie sie selbst: Oskar Mazerath trommelt den Takt zu ihrer Erzählung, Goethe und Roald Dahl trösten väterlich, die Kinder von James Joyce und Arthur Miller sind ebenfalls von ihren Vätern abgelehnt worden. Ein vielstimmiges Gespräch über Kunst, Philosophie, »Normalität« und Schuld, in dem die zu Wort kommen, die zu Lebzeiten überhört wurden.
Zusammen mit den Studierenden wurden im Laufe des Semesters von Ralf Grüttemeier Interviewfragen entwickelt, die Hagar Peeters schriftlich beantwortete und die anschließend von den Studierenden (Philipp Gerst, Verena Grave, Robin Höth, Charline Krul, Kendra Peters, Amke Postma, Doreen Schneider, Janike Weiß) übersetzt wurden. Gemeinsam mit Ralf Grüttemeier bedanken wir uns herzlich bei Hagar Peeters für ihre Flexibilität und ihre Verbindlichkeit in Seminar und Interview sowie bei den Studierenden für ihr beeindruckendes Engagement unter widrigen Umständen.
Interview: „Und während ich es schrieb, spürte ich mehr und mehr die Dringlichkeit, dem toten Mädchen das Leben zurückzugeben, das sie nie hatte, und die Erkenntnis, dass ich das tun konnte, weil es das ist, was Fiktion und nur Fiktion tun kann.“
Entstehungshintergründe
Frau Peeters, der Gegenstand Ihres Romans ist die bis vor einigen Jahren unbekannte Tatsache, dass der große chilenische Autor, Nobelpreisträger und Vorkämpfer für Menschenrechte, Pablo Neruda, eine Tochter hatte, die er Zeit seines Lebens verschwiegen hat: Malva, geboren mit einem Wasserkopf und gestorben mit 8 Jahren, 1943 in Gouda, in den Niederlanden. Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen und was hat Sie daran gereizt?
Im Jahr 2005 war ich mit meinem damaligen Freund in Chile unterwegs und suchte den Ort, an dem mein Vater am Tag meiner Geburt – 1972 in Amsterdam – gewesen war. In den Reisetagebüchern meines Vaters hatte ich gelesen, dass er damals in Temuco, im Süden von Chili, war. Einmal dort angekommen, erzählte mir jemand, dass es auch die Stadt war, in der der Dichter Neruda aufgewachsen ist. Er lebte dort von seinem zweiten Lebensjahr an bis er zum Studium in die Hauptstadt Santiago ging. Mein Freund und ich beschlossen daraufhin, alle Häuser von Neruda aus Interesse zu besuchen, denn er war ein Dichter, und ich ja auch.
In Nerudas Haus in Santiago erzählte mir die Fremdenführerin, als sie hörte, dass ich aus den Niederlanden kam, dass genau ein Jahr zuvor das Grab von Pablo Nerudas Tochter in Gouda, in den Niederlanden also, gefunden worden war. Niemand oder nur wenige Menschen wussten zu ihren Lebzeiten von ihrer Existenz, weil Neruda sie immer verheimlicht hatte. Das ist bis ins 21. Jahrhundert so geblieben: Fast niemand wusste, dass Neruda eine Tochter gehabt hatte, die in den Niederlanden begraben lag.
Nach meiner Rückkehr in die Niederlande ging ich der Sache nach. Da wir ein a-kulturelles Volk sind, hatte die Entdeckung des Grabes von Nerudas Tochter im niederländischen Gouda bis auf ein paar Artikel in regionalen Zeitungen kaum Beachtung gefunden. Die Entdeckung war die Leistung von Giny Klatser gewesen, die Übersetzerin der Autobiographie von Matilde Urrutia, der letzten von Nerudas drei Ehefrauen.
Ich fand alles an dem Thema faszinierend: das Rätsel des Verschweigens des Mädchens durch den Vater und die Überraschung der Entdeckung ihres Grabes, ausgerechnet in den Niederlanden, wo ich herkomme. Und auch die Parallele zu wichtigen Teilen meiner eigenen Biografie: Auch mein Vater hatte meine Existenz bis zu meinem elften Lebensjahr vor Familie, Freunden und Kollegen verheimlicht, und als Journalist war auch er durch Lateinamerika gereist, am liebsten nach Chile! Die Parallele zwischen dem Engagement der Väter (Neruda und mein Vater) und der Tatsache, dass sie ihre Töchter verschwiegen. Ich hätte es nicht besser treffen können, ich wusste, dass ich dieses Buch schreiben musste. Und während ich es schrieb, spürte ich mehr und mehr die Dringlichkeit, dem toten Mädchen das Leben zurückzugeben, das sie nie hatte, und die Erkenntnis, dass ich das tun konnte, weil es das ist, was Fiktion und nur Fiktion tun kann.
Sie sind eine sehr vielseitige Autorin, die hauptsächlich Gedichte schreibt – zwischen 1999 und 2019 insgesamt sieben Gedichtbände – aber auch preisgekrönte kulturhistorische Studien. Wann wurde Ihnen klar, dass Sie über Malva keinen Gedichtband und keine Kulturgeschichte schreiben wollten, sondern einen Roman – und warum? Was waren die größten Probleme, die diese Entscheidung für das Schreiben eines Romans mit sich brachte?
Zuerst begann ich Malva mit der Absicht, einen großen Gedichtband zu schreiben, aber die unterschiedlichen Schichten, Zeiten, Charaktere, Leben und Formen, die Bezug auf die Geschichte und die Charaktere hatten oder damit zusammenhingen, waren zu komplex, um sie in einem Gedichtband unterzubringen. Das wäre alles zu kompliziert und unübersichtlich geworden, dann wäre alles zu sehr „verdichtet“ worden und ich wollte das Mädchen ja schreibend wieder zum Leben erwecken.
Ich merkte schnell, dass das Genre des Romans im Vergleich zum Gedichtband mir mehr Freiheit verschaffte, als ich je gehofft hatte. Ich konnte Wirklichkeit und Fantasie, Notwendigkeit und Zufall besser miteinander verflechten und ich fühlte mich wie die Regisseurin jedes Buchstabens, jedes Satzzeichens und jedes Kapitels. Ich fand es großartig, selbst eine neue Komposition in Sprache zu erzeugen: Etwas, was es zuvor auf diese Weise noch nie gegeben hatte, was noch nie zuvor so von jemandem gemacht wurde, und was nur ich machen könnte.
Am schwierigsten fand ich die Strenge der Vorgehensweise, die ich einhalten musste: Zuerst die Realität so gut wie möglich anhand einer Vielzahl von Quellen, Archiven und Biografien kennenzulernen und aufzuspüren, so dass ich anschließend dem Mädchen, das tatsächlich gelebt hat, gerecht werden konnte. Letzteres konnte ich nur in der Fiktion tun, weil ich nicht nur die Realität so darstellen wollte, wie sie während ihres kurzen irdischen Lebens war, sondern auch das Leben zeigen wollte, das ihr vorenthalten wurde, die Vorstellungen, die dem zugrunde lagen, und das Leben so wie es hätte sein sollen. Das Schwierigste war also, dass ich erst eine kulturhistorische Studie durchführen und diese danach in einen Roman übersetzen musste, um daraus dann sprachlich Poesie und Traum zu schaffen. Und dann musste ich auch Risse und Lücken lassen und offene Enden einbauen, sodass das Werk glaubwürdig alle Kennzeichen des wohlbekannten Mängelwesens Mensch zeigen würde.
Erzählweise
Der Roman hat eine komplexe Erzählsituation: Malva erzählt aus dem Jenseits als allwissende Erzählerin, braucht aber auf der Erde eine Hand, die ihre Geschichte aufschreibt. Diese Hand leiht ihr im Roman „Hagar“, die viele Parallelen mit der Autorin Hagar Peeters aufweist. Wie sind Sie auf diese Erzählsituation verfallen? Wie viel Hagar steckt in Malva, und wie viel Malva in Hagar?
Sobald ich wusste, dass es ein Roman werden sollte und keine kulturhistorische Studie oder Biografie, kein poetisches Epos, kämpfte ich eine Weile damit, aus wessen Perspektive ich ihn schreiben würde: Nerudas? Der Mutter? Von Malva selbst aus? Neruda fiel weg, weil über ihn schon so viel geschrieben worden war, auch aus seiner Perspektive, und ich fand, dass er schon genug Ansehen und Aufmerksamkeit erhalten hatte. Zudem glaube ich an die anregende Vorstellung, dass man zur Statuserhöhung des Unbeachteten beitragen kann, wenn man ihm doch Aufmerksamkeit schenkt. Die Mutter? Ich wusste, dass schon jemand dabei war, über sie zu schreiben und sie war als Hauptperson weniger herausfordernd, weil mehr über sie bekannt war – und zudem war das, was bekannt war, ziemlich deprimierend. Um ihr gerecht zu werden, hätte ich dieses Elend beschreiben müssen und das schien mir eintönig und langweilig und nicht das, was ich wollte. Übrig blieb Malva, ein sprunghaftes Kind, das nicht wirklich springen konnte, eine Denkerin, die in der Realität geistig zurückgeblieben war, kurzum: Indem ich mich nicht an die Realität hielt, konnte ich diese gerade zeigen.
Irgendwann hatte ich den Dreh raus, wie Malva klingt – scharfsinnig und ironisch. Dann folgte von selbst, dass sie ihre Geschichte jemandem erzählen würde, und was könnte mehr Spaß machen, als sie mir zu erzählen, sodass ich der Ghostwriter eines Geistes wäre? Denn sie war ein Geist und konnte daher selbst keinen materiellen Stift halten, weshalb sie meine Hand aus Fleisch und Blut nötig hatte, und es wurde alles gleichermaßen logisch und unausweichlich, sobald ich schrieb – eines folgte ganz natürlich aus dem anderen, als ob es mir von einem größeren Wissen diktiert wurde. Ich bin nicht wie Malva, sie ist viel klüger und weiser als ich, und auch viel nachtragender. Aber wir haben gemeinsam, dass wir abwesende Väter hatten, die sich gleichzeitig als Kämpfer für das Gute sahen. Und wir beide lieben Tanzen und Tortillas.
Ich bin auch einmal allein auf einer großen Stute in Ungarn über die Puszta geritten und daran musste ich denken, als ich Malva auf einem kleinen Pferd mit ihren Freunden über die Pampa des Jenseits galoppieren ließ. Und dann gibt es wahrscheinlich unzählige Ähnlichkeiten in den Details, ich könnte sie wahrscheinlich Zeile für Zeile aufzählen, aber wenn ich das tun würde, wäre ich stundenlang beschäftigt. Auf jeden Fall habe ich mehr Ähnlichkeit mit der Malva in meinem Buch als mit der Malva, die es tatsächlich gab. Ich denke, die Malva im Buch ist eine Kreuzung zwischen mir und der echten Malva, ergänzt um Magie, Trost und Hoffnung.
Die Kehrseite von Glück und Erfolg: Den Verschwiegenen das Wort
Oliver Jungen schreibt in seiner Rezension des Romans in der Frankfurter Allgemeine vom 6. April 2019, Malva sei „ein Buch der Entzauberung“: „Wer das liest, wird Pablo Neruda ächten“. Inwiefern ist das Buch in der Tat eine Abrechnung? Eine Abrechnung mit kreativen Vätern, die ihre behinderten Kinder verschweigen (im Buch kommt neben Neruda zum Beispiel auch Arthur Miller vor, der seinen vom Down-Syndrom betroffenen Sohn Daniel verschwieg)? Inwiefern eine Abrechnung mit jemandem, der für Gerechtigkeit in der Welt kämpft, aber zugleich das eigene behinderte und hilfsbedürftige Kind „verbannt, um anschließend selbst glücklich weiterzuleben“, ohne sich auch nur noch eine Sekunde um dieses Kind zu kümmern, wie im Roman Sokrates im Jenseits Neruda vorwirft?
Ich denke, „Abrechnung“ ist hier ein völlig falsches Wort, viel zu negativ und absolut, bösartig und nachtragend. So ist das Buch nicht geschrieben und jeder, der es so sieht, hat es völlig missverstanden. Ich wollte nur die Kehrseite der Medaille des Glücks und des Erfolgs der edlen Nobelpreisträger und Kämpfer für das Gute und brillanten Künstler zeigen: diejenigen, denen sie diesen Erfolg verdanken, die aber selbst im Schatten bleiben mussten. Diejenigen, die – trotz des hohen moralischen Charakters der genialen Persönlichkeiten, die in den Almanachen verewigt werden – abgelehnt und verschwiegen wurden: ihre eigenen Kinder wohlgemerkt!
Wie Bertolt Brecht schreibt in seiner Dreigroschenoper – auf dieses Zitat beziehe ich mich in Malva, und übrigens auch in Gerrit de Stotteraar, meinem Sachbuch über einen berühmten unverbesserlichen niederländischen Einbrecher: „Denn die einen sind im Dunkeln/ Und die anderen sind im Licht./ Und man sieht nur die im Lichte/ Die im Dunkeln sieht man nicht.“
Und ich wollte diesen Verschwiegenen und mit Füßen Getretenen eine Stimme geben, genauso wie Neruda, Miller, Grass und ihresgleichen selbst sagten, dass sie den Verschwiegenen und mit Füßen Getretenen eine Stimme geben wollten. Mein Roman ist also eigentlich ganz nerudianisch: Ich setze das linksidealistische Credo „Den Verschwiegenen das Wort“ in die Tat um, und zwar konsequent. Dabei zeige ich die breiteste und nuancierteste Palette von Emotionen, die man von den verschwiegenen und verstoßenen Kindern erwarten kann: keine stumpfe Beschuldigung, sondern Trauer, Sehnsucht, Leid, Liebe, Hoffnung. Das ganze Buch ist ein Liebesbrief an den Vater, in einer Sprache, die ihm vielleicht gefiele, in der Hoffnung, endlich von ihm gesehen und anerkannt zu werden.
Schreiben und Menschlichkeit
Der niederländische Autor W.F. Hermans hat einmal über sein eigenes Werk gesagt: „Ich schreibe immer das gleiche Buch“. Inwiefern würden Sie das auch über Ihre eigenen Bücher sagen? Oder weniger plakativ gefragt: Gibt es einen roten Faden, der all Ihre Bücher – egal ob Gedichtbände, eine Biographie des niederländischen Meister-Ein-und-Ausbrechers Gerrit der Stotterer, oder Ihren Roman Malva miteinander verbindet? Könnte man diesen roten Faden im Wecken von Empathie sehen? Sie haben ja einmal in einem Interview mit Thomas Blondeau 2009 gesagt: „Ich will Beziehungen zwischen Menschen untersuchen, sodass Menschen sensibler für ihre jeweiligen Nöte werden.“
Ja, das Erhöhen von Empathie ist schon ein zu Grunde liegendes Ziel, aber nicht das Thema an sich, nicht der rote Faden. Das ist eine gute Frage und ich muss da lange drüber nachdenken. Ich weiß, dass ich als Kind die Mission hatte, der Welt zu zeigen, dass es möglich ist sich als kreatives Genie gleichzeitig mit anderen in Verbindung zu setzen. Dass das alte Entweder/Oder (entweder Künstler oder Vater/Mutter, der/die für das Kind da ist; entweder Genie oder altruistischer Stubenhocker) zu einseitig, zu wenig ist. Ich gehöre als alleinerziehende Mutter, die zugleich Autorin ist, zur ersten Generation in der Geschichte der Menschheit, die Frauen dazu in die Lage versetzt, gleichzeitig alleinerziehende Mutter und Autorin zu sein, aber inwiefern wird die Pionier-Rolle gesehen und geschätzt?
Virginia Woolf beschrieb in A Room Of One’s Own die Anforderungen an professionelle Schriftstellerei von Frauen wie über finanzielle Unabhängigkeit verfügen und ein Zimmer für sich selbst haben, mit einer Tür, die man abschließen kann. Kinder kamen in dieser Beschreibung nicht vor. De Beauvoir schreibt in Le Deuxième Sexe im Kapitel über Mutterschaft die ersten zehn Seiten nur über Abtreibungen.
Beide Frauen wollten keine Kinder, sie begriffen, dass Mutterschaft und Schriftstellerei schwer zu vereinbaren sind. Mutterschaft fiel bis vor sehr kurzem noch unter „bürgerlich“, einengend, Joch der Frau und Anpassung an die patriarchalen Strukturen. Aber ich bin der Meinung, dass Kinder kriegen und Schreiben sich in einer gerechten Gesellschaft nicht gegenseitig ausschließen müssen, genauso wenig wie das Eingehen emotionaler Verbindungen mit anderen und kreative Freiheit sich ausschließen.
Aber das wird, auch heute noch, oftmals sehr anders gesehen und es werden viel zu wenig Maßnahmen getroffen, um alleinerziehende Mütter-Genies zu unterstützen, um auch für sie eine alternative Form eines Room Of One’s Own zu schaffen. Diese Wirklichkeit und deren Möglichkeiten untersuche ich in einem Triptychon, an dem ich gerade schreibe und von dem der erste Teil kurz vor der Corona-Pandemie erschienen ist: der Gedichtband De schrijver is een alleenstaande moeder (2019, Der Schriftsteller ist eine alleinerziehende Mutter). Aber eigentlich entspringen alle meine Bücher dem Streben, Schreiben und Menschlichkeit Hand in Hand gehen zu lassen und in einigen Büchern wird das Thema auch explizit im Inhalt artikuliert. Dann ist es nicht mehr nur die Triebfeder, sondern auch zum Inhalt des Buches geworden.
Gibt es für Sie auch Grenzen der literarischen Empathie, des sich Hineinversetzen in andere und wenn ja, wo liegen die?
Nein, literarisch gibt es keine Grenzen und ich kann mich in jeden und alles hineinversetzen – was nicht heißen will, dass ich das, worin ich mich hineinversetze, per se auch gutheiße – aber ich kann mich auch in einen Stein, einen Regenbogen oder ein Sandkorn versetzen, in ein UFO oder das Fabelwesen blauwbilgorgel des niederländischen Dichters C. Buddingh´ (zu Deutsch etwa: Blaupogurgel), ohne damit vorzugeben, dass ich absolute Kenntnis über diese Erscheinungen und Erdichtungen habe. Schreiben ist für mich nichts anderes als das Verständnis, das ich selbst von anderen zu haben glaube, von dem was da ist, was mich umgibt, was aus meiner eigenen Fantasie entspringt, in Worten zum Ausdruck zu bringen.
In einer frühen Phase Ihres Schreibens haben Sie einmal in einem Interview gesagt: „Ich mag keine intellektuelle Poesie.“ Poesie müsse „direkt treffen“. Inwiefern findet die heutige Dichterin Hagar Peeters das immer noch? Inwiefern die Romanautorin? Könnte man nicht sagen, dass Prosa als Gattung nie so direkt treffen kann wie Lyrik? Dass Prosa immer viel Erzählzeit braucht, um genau so intensiv wie Lyrik treffen zu können?
Am Anfang meiner Karriere als Autorin war ich Rap- und Performance-Dichterin. Bereits zwei Jahre bevor ich meinen ersten Gedichtband veröffentlichte, konnte ich von Lesungen meiner Gedichte auf Bühnen leben. Hierbei trat die Vielschichtigkeit von Lyrik in den Hintergrund, aber andere Aspekte kamen dafür dazu: Klangfarbe, Timing, Emotion in der Stimme, die Eingängigkeit des Gedankengangs und die Bildhaftigkeit des Beschriebenen. Man konnte nicht zurückblättern, den Pausenknopf drücken oder wiederholen: Das Gedicht spielte sich in dem Moment ab, in dem es vorgetragen wurde, was ich immer auswendig tat und wobei die Musikalität und der Rhythmus in der Sprache wesentlich waren. Ich denke, ich stand in der Tradition der Fünfziger, des Jazz, der Beat Poets, der amerikanischen Rap Poets und es hat mir einen gewaltigen Kick gegeben, meine Gedichte auf meine Art rezitieren zu können. Es wurde damals oft gefragt, ob Poesie für die Bühne auch in einem Gedichtband gut funktionieren würde, und Kritiker waren erstaunt, dass meine Poesie zeigte, dass genau dies der Fall war.
Ich denke, Prosa kann auch direkt berühren – ob etwas direkt von einer Bühne beim Publikum ankommt oder nicht, ist nicht abhängig von Gattungen. Es gibt historische Reden (Prosa!), die das sofort getan haben (denken Sie an Martin Luther King) und es gibt Romanautoren, denen ich wie gebannt mit Staunen und höchster Aufmerksamkeit alles aufsaugend zuhöre, wenn sie Auszüge aus ihren Romanen lesen. Das erlebte ich manchmal bei Gerrit Komrij, bei Peter Verhelst, bei Joost Zwagerman, bei Ronald Giphart, bei Hugo Claus und Remco Campert, wenn sie aus ihren Geschichten oder aus Romanen lasen, und ich bedaure, dass ich so wenige Frauen gehört habe, die ihre Romane vorlesen, weil diese zu der Zeit, als ich selbst als aufstrebendes Poesie-Talent so viel Zeit auf den Bühnen verbrachte, so wenig in Programme eingeladen wurden.
Feminismus und Religion
Sie haben Ihre eigene Sozialisation einmal mit einem Vergleich illustriert: So wie andere in ihrer Jugend mit dem Katholizismus imprägniert worden sind, so seien Sie durch den Feminismus geprägt worden. Wie zufällig gewählt war dieser Vergleich von Feminismus mit einer Religion, wo genau sehen Sie Parallelen, wo sind die Grenzen des Vergleichs?
Der Vergleich ist sicher kein Zufall. Mein Vater, den ich in den ersten sechs Jahren meines Lebens nicht kannte, kommt aus einer jüdisch-protestantischen Familie, aber davon bekam ich kaum etwas mit, weil ich, wie bereits gesagt, schon 11 Jahre alt war, als ich anfing, ein Teil dieses Zweigs der Familie zu werden.
Meine Mutter kommt aus dem katholischen Limburg, sie musste als Kind täglich zur Kirche gehen und sonntags drei Mal. In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat sie sich, wie viele andere, davon losgesagt, weil sie die Ungleichheit der Chancen, der Behandlung und der Möglichkeiten zwischen Jungen und Mädchen und Frauen und Männern, die sie auch am eigenen Leib erfuhr, unerträglich fand. Sie zog Mitte der 60er Jahre in das wilde, freie, experimentelle, progressive Amsterdam der Provos, Hippies und Dolle Minas und traf dort meinen unkonventionellen Vater, der sich nicht binden wollte, auch nicht an sie und auch nicht, als sie von ihm schwanger war.
Meine Mutter versuchte, die alleinerziehende Mutterschaft mit Frauengesprächsgruppen zu kombinieren – sie trat den Roten Frauen der sozialdemokratischen ‚Partij van de Arbeid‘ bei. Die hatten aber für ihre Schwanger- bzw. Mutterschaft und die damit verbundenen Einschränkungen bei der Teilnahme an den Diskussionsgruppen wenig Verständnis (‚Ich habe auch eine Katze zu Hause‘ war eine oft gehörte Reaktion darauf, wenn jemand zu seinem Kind musste).
Ich ging mit meiner Mutter in die Feministische Buchhandlung Xantippe und hüpfte auf dem Sofa zu den Liedern von Valium 10 und deren Kommentar zu „Mother’s little helper“ der Rolling Stones, zu „Het vrouwenkabaret“ (Das Frauenkabarett) und Cobi Schreijers „Brood en Rozen“ aus dem Jahr 1978, vor allem zu ihrer wunderbaren Interpretation von „Amanda“ des ermordeten chilenischen Protestsängers Victor Jara – die Platten, die meine Mutter jeden Tag spielte. Diese Songtexte kannte ich schon als Sechsjährige auswendig und sang sie mit und verstand, wovon sie handelten. Nicht wirklich Themen für Kinder, aber ich wurde dadurch früh weltklug und selbstständig.
Mein Lieblingsspielzeug war eine Ziehpuppe aus Pappe von Minister Van Agt, der als katholischer Justizminister gegen die Legalisierung der Abtreibung war. Wenn man an seinem Schwanz aus Pappe zog, flogen seine Arme und Beine in die Luft, das fand ich sehr lustig. Ich denke, man kann den Feminismus als prägenden Hintergrund mit der Rolle vergleichen, die eine bestimmte Religion für andere gespielt hat. Seine Bedeutung war für mich eher sozial: Seine Rituale und täglichen Praktiken, aber auch die mit ihm verbundenen humanistischen Ideen von Gleichwertigkeit zwischen allen Menschen im Allgemeinen und zwischen Frau und Mann im Besonderen, seine Anti-Hierarchie auf jeder Ebene haben mich tief geprägt.
Zuletzt geändert am 8. Mai 2023






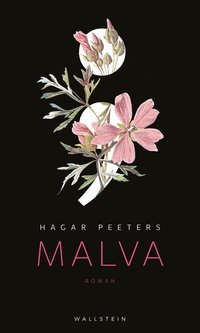
 zurück
zurück